Von Nikolas Rode
Künstliche Intelligenz ist längst Teil unserer Gegenwart geworden. Doch was bedeutet das für Künstler*innen und ihre Werke? Wie verändert sich das Berufsfeld? Und vor allem: Wer gilt eigentlich als Urheber in diesen Fällen?
Vom Papst in weißer Pufferjacke, bis hin zu Abbildungen bekannter Politiker im Renaissance-Stil: In der Welt der künstlich generierten Fotos erscheint mittlerweile alles möglich. Mit Programmen wie Jasper Art, Runway oder Midjourney lassen sich binnen Sekunden Bilder und Kunstwerke erstellen.
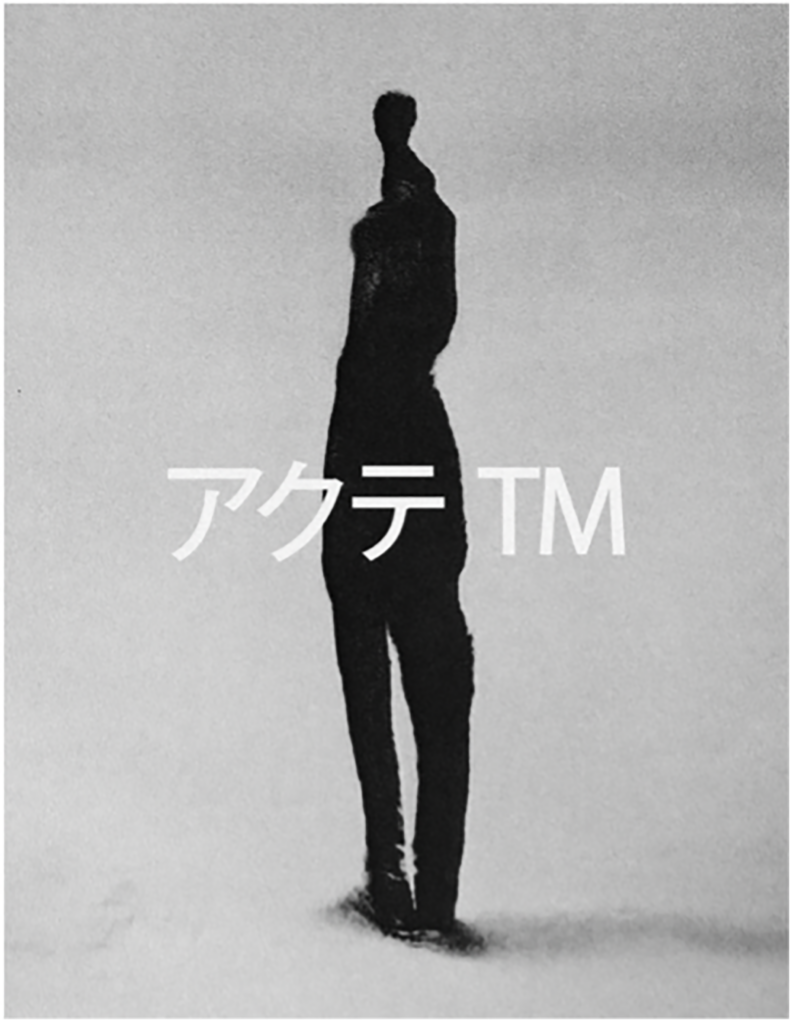
Den Überbegriff dafür bildet das Text-to-Image-System: Diese Programme sind darauf spezialisiert, auf Anweisung, auch Prompt genannt, ein beliebiges Bild zu erstellen, welches aus verschiedenen Datensätzen errechnet wird. Schon ist ein weiteres Bild kreiert worden. Das machen sich auch Kunstschaffende und Fotograf*innen zunutze. Wie arbeitet man aber genau mit diesen Programmen und wer besitzt die Rechte an diesen Fotos? In Österreich schützt das Urheberrecht derzeit nur „von Menschen geschaffene Werke“ (§ 1 Abs. 1 UrhG): Künstlich generierte Werke sind derzeit urheberrechtlich demnach nicht geschützt.
SUMO lässt drei Personen zu Wort kommen: den Fotografen Matthias Leidinger, den Unternehmer Stefan Pichler und die Rechtsanwältin Jeanette Gorzala. Matthias Leidinger spricht über seine Arbeit mit künstlich intelligenten Programmen und die zukünftigen Auswirkungen dieser auf sein Berufsfeld. Stefan Pichler hat sich gründlich in seiner Masterarbeit mit dem Thema Urheberrecht von generierten Werken auseinandergesetzt. Jeanette Gorzala hat sich auf das Gebiet „Recht bei künstlich generierten Fotos“ spezialisiert und gibt Ausblicke auf die Zukunft, sowie Grauzonen und Streitpunkte der Thematik.
Zwischen Schutz und Schranken
Im österreichischen Recht ist das Urheberrecht im Persönlichkeitsrecht sehr stark verankert, sagt Pichler. Die Urheber*innen bringen ihre Persönlichkeit in das Werk ein, aber genau dieser Fakt macht vollkommen generierte Bilder schwer mit dem Urheberrecht vereinbar. Hier sei die Persönlichkeit des Schaffenden schwer wiederzuerkennen. Gorzala erklärt, dass rechtlich die Urheberschaft in Europa und auch nach dem österreichischen Urheberrechtsgesetz aktuell nur einer natürlichen Person zusteht. Im Falle der Abwandlung von Werken spricht man von einer Werkbearbeitung. Möglich ist auch, dass durch die Benutzung eines Werks im künstlerischen Schaffensprozess ein selbständiges neues Werk entsteht. Hier weist Gorzala darauf hin, dass bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz bei Bearbeitungen oder der Erstellung neuer Werke sowohl Fragen der Urheberschaft als auch der Haftung zunächst beachtet werden müssen. „Bei der Werkbearbeitung eines Bildes können die ursprünglichen Künstler*innen jedoch klagen, dass ihre Bilder benutzt wurden“, so Pichler, welcher sich in seiner Masterarbeit gründlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Bei künstlich generierten Bildern, welche keinen Urheber*innen zustehen, heißt es nicht, dass diese von jeder/ jedem benutzt werden dürfen.
Der Urheber bestimmt, wie sein Werk genutzt werden kann – was grundsätzlich nicht durch den Urheber erlaubt wurde, ist unzulässig. Künstler*innen können zusätzlich vorab klar schreiben, dass das Werk für das Trainieren von Künstlicher Intelligenz nicht verwendet werden darf und falls dies trotzdem passiert, können Ansprüche geltend gemacht werden. „Das Beweisthema, wessen Werke verwendet wurden, ist das Schwierige“ erklärt Gorzala. In Australien gab es vor kurzem ein interessantes Urteil: „Dort überlegt man, maschinelle Urheberschaft anzuerkennen.
Auf europäischem Gebiet wurde eine mögliche Rechtspersönlichkeit für Maschinen zwar diskutiert, jedoch abgelehnt: Auch in Österreich kann nur eine natürliche Person Urheber*in sein“, sagt Gorzala.
Grauzonen und Grenzbereiche
Komplex ist die Rechtslage beim Eingeben des Prompts in Verbindung mit den unterschiedlichen Nutzungsbedingungen der Programmanbieter*innen. „Die Plattformen sichern sich sehr weitreichende Rechte zu, welche in ihren AGBs zu finden sind. Die Norm ist, dass derjenige, der den Prompt macht, ein beschränktes Nutzungsrecht für das Ergebnis hat“, erklärt Gorzala. Die Plattformen sichern sich oft Verwendungsrechte z.B. an den Inputdaten oder auch am Ergebnis, welches durch den eigenen Prompt entsteht. Sehr oft unterliegen die AGBs zudem US-Recht. Eine weitere Grauzone ist, ab wann das Werk eine so einzigartige geistige Schöpfung ist, dass es wieder ein neues Werk darstellt: Eine Frage, die vor allem Kunstschaffende sehr beschäftigt. Eine zentrale Frage ist, welche Daten man zum Trainieren und Testen verwenden darf. „Viele neue Plattformen, die zum Beispiel Stockfotos anbieten, klären bereits in den AGBs, dass ihre Werke nicht verwendet werden dürfen. Zur Frage der unrechtmäßigen Verwendung von Daten für das Trainieren von generativer Bild-KI gibt es bereits anhängige Gerichtsverfahren in den USA“, sagt die Rechtanwältin Gorzala.
„Die Kreativität sollte unbedingt honoriert werden“
Auf die Frage der Ethik bei künstlich generierten Fotos angesprochen, erklärt Gorzala vorab, wie faszinierend es sei, was man mit dieser Technologie bereits leisten kann. Obwohl wir ihrer Meinung nach noch entfernt von Perfektion sind, wurde im Bereich von Bildern, Videos und im Audio-Bereich bereits Großartiges geleistet. Es geht dabei immer um die Frage, ob das bereits etwas Neues ist oder einfach nur eine neue Kombination von vorhandenen Daten. Für Gorzala steht die menschliche Kreativität immer im Vordergrund:
„Es sollte ein Zusammenspiel zwischen einer natürlichen Person und einer Technologie sein, die einem nur dabei hilft, besser zu arbeiten oder zu experimentieren. Es muss ein Miteinander sein, bei dem die Intuition der Kunstschaffenden nie untergehen dürfe.“
Die Idee dahinter in Form des Prompts kommt vom Menschen, der sich dieser Technologie bedient. Das Erstellen solcher Fotos ist also generell nicht verwerflich, vertritt Gorzala. Künstler*innenrechte müssen aber respektiert und geschützt werden, vor allem im Digitalkunstbereich: „Die Kreativität sollte unbedingt honoriert werden. Niemals sollten Künstler*innen ausgebeutet werden, da die Kunst einen gesellschaftlichen Aspekt erfüllt.“ Künstliche Intelligenz bietet ein riesiges Potenzial, aber der Mensch sollte immer im Vordergrund stehen, damit das Verhältnis nicht kippt.
„Unethisch ist das Einsetzen der Programme dann, wenn es darum geht Persönlichkeitsrechte zu verletzen oder Personen in unvorteilhaften Arten und Weisen darzustellen, insbesondere in Richtung Gewalt oder Pornographie. Desinformationen durch Deep-Fakes und Fake News zu erzeugen, ist ein weiterer völlig unethischer Aspekt und kann massive Schäden verursachen“, so Gorzala.
Künstliche Kreativität unter Kontrolle?
Das Wichtigste in diesem Bereich ist, Klarheit über den Umgang mit Daten zu schaffen, die die Grundlage der Modelle bilden. Für Modellentwickler*innen müssen klare Regelungen geschaffen werden. Gorzala meint, dass sich durch eine EU-weite Regelungen, EU AI Act genannt, auf europäischer Ebene etwas verändern wird: „Dabei geht es vor allem darum, dass von Herstellerseite
bestimmte Standards und Regelungen in geordnete gesetzliche Wege geleitet werden müssen. Man rechnet damit, dass dieser Prozess Ende 2023 abgeschlossen sein und Anfang 2024 in Kraft treten wird, sollten keine weiteren technischen Entwicklungen dazwischenkommen“, fügt Gorzala hinzu.
Der zweite wichtige Punkt in Zukunft ist die Transparenz, vor allem dort, wo es sensibel ist. Künstlich generierte Werke sollten, laut Gorzala, kennzeichnungspflichtig sein, vor allem dort, wo diese für Desinformation instrumentalisiert werden können, beispielsweise wenn es um Personen des öffentlichen Lebens geht. „Die Tools werden bleiben, die Standards müssen dazukommen, um eine ehrliche Arbeitsweise zu gewährleisten. Besonders bei wissenschaftlichen Arbeiten sollte es eine Kennzeichnung geben. Es besteht also viel Entwicklungsarbeit“, vertritt die Rechtsanwältin.
Die Fotografie von morgen: Veränderung der Arbeitsweisen
Leidinger glaubt, dass in den kommenden Jahren kreatives und konzeptuelles Denken weitaus mehr in den Vordergrund rücken werden und vielleicht auch das physische und analoge Arbeiten, wie beispielsweise durch Dunkelkammerdrucke, wieder stark an Wertigkeit dazugewinnen, da sie eine Authentizität und Handarbeit verkörpern, wie es eben Programme nicht können. Hingegen könne er sich gut vorstellen, dass Branchen wie die Produktfotografie starke Markteinbrüche zu verzeichnen haben werden, da in Zukunft die Erstellung solch kommerzieller Aufnahmen durch Künstliche Intelligenz weitaus kostengünstiger und effizienter werden könnte.
Vielleicht wird die Fotografie in ihrer Denk- und Arbeitsweise dadurch aber auch freier. „Ein guter Vergleich ist das Zeitalter, in der die Fotografie die Malerei abgelöst hat: Die Möglichkeiten mit Künstlicher Intelligenz zu arbeiten könnte hier einen ähnlichen nächsten Schritt darstellen“, rundet Leidinger ab.

Wer besitzt in der Praxis nun das Urheberrecht?
Im Zuge des Gesprächs, zeigte SUMO Gorzala und Pichler zwei Beispiele und fragte sie nach der urheberrechtlichen Auslegung. Gorzala meint, falls das Bild komplett über Midjourney generiert wurde, stellt sich einerseits die Frage, was dieses Programm in den AGBs stehen hat und andererseits, was die Datengrundlage des generierten Bildes ist. Ihre Einschätzung der AGBs ist, dass sich Midjourney ein Verwendungsrecht am Bild zusichert und auch der Ersteller des Bildes ein Verwendungsrecht erhält. Ob der Ersteller auch Urheber*in des Werks ist, hängt vom Erreichen des notwendigen Levels an Schöpfungskraft ab.
Leidingers Arbeitsweise sowie die urheberrechtliche Auslegung seines Fotos
Nachdem Leidinger die Fotos von einem männlichen Model gemacht hatte, bearbeitete er die verschiedenen Fotos mit den verschiedenen Posen alle ähnlich. Das benutze Programm für dieses Projekt war Runway ML, eines der innovativsten Programme in der Welt der künstlichen Fotogenerierung.
„Die Künstliche Intelligenz versucht also basierend auf ihrem Wissen zu erkennen, was sich in seinen Bildern befindet und daraufhin neue, ähnliche Bilder zu generieren. Man könnte also sagen, sie versucht die Essenz der Bilder zu verstehen, um neue zu erschaffen“, so Leidinger.
Was das Foto des Fotografen betrifft, vertritt Pichler die Meinung, dass die Künstliche Intelligenz mit seinen Bildern trainiert wurde: „Die ganze Eingabe kam von ihm, sowie die Ausgabe und die Steuerung von der Künstlichen Intelligenz. Das bedeute, der Künstler spiele hier bei der Erschaffung eine tragende Rolle und somit greife das Urheberrecht bei Matthias Leidinger.“
„Er ist die natürliche Person, der die Grundlage für die Fotos geliefert hat und jedenfalls deren Urheber. Zu prüfen sind jedenfalls die AGBs von Runway, und ob sich der Programmhersteller darin Nutzungsrechte am Bild sichert. Der künstlich-intelligente Algorithmus ist auf jeden Fall nicht der Urheber“, meint Gorzala ebenso, ohne eine gründliche Prüfung durchzuführen.

